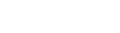Titel: 'LIFE IN A DAY' (2011)
Regie: KEVIN MacDONALD
Produktion: RIDLEY & TONY SCOTT
Schnitt: JOE WALKER
Musik: MATTHEW HERBERT, HARRY GREGSON-WILLIAMS
Genre: DOKUMENTARFILM
Eine Fallschirmspringerin stürtzt sich barfuß ins blaue Nichts, durchbricht im freien Fall dichte Wolken; ein kleines spanisches Mädchen klettert an kräftigen Männern zur Spitze eines Menschenturms entlang; ein junger Mann bringt aufgeregt seiner Großmutter in einem Telefongespräch bei daß er schwul ist; ein Koreaner durchreist seit Jahren auf seinem Fahrrad die ganze Welt, und sehnt sich nach seiner Heimat beim Anblick einer Fliege die in seiner Suppe schwimmt; ein Amerikaner lächelt süffisant während er im Fahrersitz seines Lamborghini sitzt; in Peru muss sich ein Siebenjähriger mit Süßigkeiten als Lohn für Schuheputzen zufrieden geben, während auf der anderen Seite des Globus deutsche Teenager auf der Duisburger Loveparade um ihre Freunde trauern...
All diese Schnipsel entstanden an einem einzigen Tag, dem 24. Juli 2010, und sind Teil eines weltweit einzigartigen Experiments. Drei Wochen vorher rief das Team rund um Produzent Ridley Scott (Alien, Gladiator) und Regisseur Kevin MacDonald (Last King of Scotland, State of Play) die gesamte Youtube-Community auf, an besagtem Tag ihr Leben zu dokumentieren. Das Ergebnis ist überwältigend: 80.000 Clips aus 192 Länder wurden eingereicht, und addierten sich zu einer Laufzeit von 4.500 Stunden Videomaterial. Keine leichte Aufgabe diese Masse auf 95 Minuten zu reduzieren.
Doch die Mühe hat sich gelohnt. Kevin MacDonald gelingt eine dithyrambische Ode an das Leben im 21. Jahrhundert. Verspielt, heiter, vergnügt, tiefgründig, melancholisch, tragisch, erschreckend, dynamisch und unterhaltsam verbindet dieses Zeitdokument bedeutungsschwer mit trivial, profan mit sakral, und deckt somit das ganze Emotionsspektrum, sowohl beim Protagonisten als auch beim Betrachter. Ridley Scott's Mosaik zielt auf die Empathie des Zuschauers, kitzelt das Zwerchfell, entlockt einem so manche Träne, regt aber jedenfalls zum Nachdenken an.
Die Erzählung folgt chronologisch dem alltäglichen Ablauf, beginnt mit dem Erwachen in den frühen Morgenstunden, und endet mit dem Lichtausschalten kurz vor Mitternacht. Anfang und Ende werden hier in jeder möglichen Analogie wiederholt. Bei der Geburt seines Kindes fällt der filmende Vater in Ohnmacht; assoziativ folgt darauf das Töten eines Rindes im Schlachthof. Das Leben im Zeitraffer. Zwischen Geburt und Tod ist fast alles was beginnen, und wieder enden kann im Leben eines Individuums, vertreten. So sieht man beispielsweise einen jungen Mann der seine Partnerin in Las Vegas kniend mit einem Heiratsantrag überrascht, und nur wenige Augenblicke später einen anderen der von seiner Freundin verlassen wird, bevor es eigentlich begonnen hat. Die scheinbar einzige Konstante im Leben scheint die platonische Liebe zu sein, die der Film regelrecht feiert.
Um innerhalb dieses Bilder-Potpourri halbwegs eine Struktur herzustellen, wird die Erzählung in drei Kapitel-ähnliche Fragen eingeteilt: Was liebst du? Was fürchtest du? Was hast du in deiner Tasche? Erstaunlich was da alles an Antworten auftaucht. Und die Menschen scheinen sich eine Freude daraus zu machen sich mit ihren intimsten Vorlieben und Ängsten der ganzen Welt zur Schau zu stellen. Dieser Film ist der perfekte Spiegel für den Trend von globaler Dimension, der durch Facebook, Myspace, Twitter, Youtube und co. sichtbar wird: die ständig wachsende Tendenz des Menschen zum Exhibitionismus und exzessiver Selbstdarstellung. Durch die weltweite Vernetzung wird jeder Person mit Internetzugang ihre Chance auf die berüchtigten 15 Minuten Ruhm (in "Life in a Day" nur noch 15 Sekunden) um ein Vielfaches erleichtert. Folglich wird der Zuschauer gezwungenermaßen in die Rolle des Voyeurs gedrängt. Der dermaßen tiefe Einblick ins Privatleben mancher Menschen, den dieser Film gewährt, mag auf den Ein- oder Anderen verfremdend wirken. Konsequenterweise können Zweifel an der Authentizität des Gezeigten auftreten. Man ist eben nicht gewohnt das echte Leben im Kino zu beobachten.
Zusätzliche Zweifel kommen bei einigen Aufnahmen auf, die offensichtlich nicht von einfachen Privatleuten stammen. Die Kameraoptik mancher Bilder lässt erahnen daß Ridley Scott wohl seine Kamerateams in die entlegensten Ecken der Welt geschickt hat, um möglichst viel vom Globus zu decken. "Life in a Day" ist seinem Mantra also nicht treu, und bricht seine eigene Regeln.
Ein Kontrapunkt in der Narrative ist die Katastrophe auf der Duisburger Loveparade, deren beunruhigende Bilder erst gegen Ende des zweiten Drittel zum Einsatz kommen. Der Film schafft während diesen wenigen Minuten in Kombination mit Musik und Originalton eine verstörende Atmosphäre, die den damaligen Horror wohl authentisch wiedergeben muss. Fast noch erschreckender als die Bilder selbst ist der Ton, der über die psychedelischen Techno-Beats hinaus, sowohl Jubelschreie als auch Angstschreie erkennen lässt. Die Einen tanzen und feiern extatisch, während nur wenige Meter weiter, infernalische Zustände herrschen, und Andere sterbend auf der Straße liegen. Man fühlt sich erleichtert wenn die Szene vorbei ist.
Die letzten Minuten des Films bestehen aus dem Monolog einer jungen Frau, die sich gegen Mitternacht im Auto sitzend selbst auf Videoband aufnimmt, und uns gesteht, daß sie den ganzen Tag vergebens auf "etwas besonderes" gewartet hat, das schlussendlich nie eingetreten ist. Mit großer Enttäuschung stellt sie fest, daß der Tag wohl stinknormal war. Und doch fühlt sie sich als wäre der Tag einzigartig.
Während am Nachthimmel ein Gewitter aufzieht, bringt sie dann die Essenz des Filmes auf den Punkt: es gibt keinen normalen Tag. Jeder Tag ist ein Geschenk das man auskosten soll. Die altbekannte Leier also, Carpe Diem. Letztendlich lässt sich aus diesem exorbitanten, weltumfassenden Projekt, trotz seines Größenwahns, doch nur die Weisheit eines Glückskeks herausdestillieren.
Zusammenfassend ist "Life in a Day" ein äußerst intressantes Experiment, und schon alleine wegen der frischen Idee sehenswert. Zukünftige Generationen werden dankbar sein für dieses wertvolle Zeitdokument, das bezeugt wie es gewesen sein muss, am 24. Juli 2010 auf dem Planeten Erde gelebt zu haben.
Fazit: unterhaltsames, süß-saueres Patchwork-Werk, das dem Zuschauer noch eine Weile im Kopf nachhallen, und einen mit existentiellen Fragen beschäftigen wird. Sollte man gesehen haben.
5/6 Sterne.
M!LLi Schlesser
Regie: KEVIN MacDONALD
Produktion: RIDLEY & TONY SCOTT
Schnitt: JOE WALKER
Musik: MATTHEW HERBERT, HARRY GREGSON-WILLIAMS
Genre: DOKUMENTARFILM
Eine Fallschirmspringerin stürtzt sich barfuß ins blaue Nichts, durchbricht im freien Fall dichte Wolken; ein kleines spanisches Mädchen klettert an kräftigen Männern zur Spitze eines Menschenturms entlang; ein junger Mann bringt aufgeregt seiner Großmutter in einem Telefongespräch bei daß er schwul ist; ein Koreaner durchreist seit Jahren auf seinem Fahrrad die ganze Welt, und sehnt sich nach seiner Heimat beim Anblick einer Fliege die in seiner Suppe schwimmt; ein Amerikaner lächelt süffisant während er im Fahrersitz seines Lamborghini sitzt; in Peru muss sich ein Siebenjähriger mit Süßigkeiten als Lohn für Schuheputzen zufrieden geben, während auf der anderen Seite des Globus deutsche Teenager auf der Duisburger Loveparade um ihre Freunde trauern...
All diese Schnipsel entstanden an einem einzigen Tag, dem 24. Juli 2010, und sind Teil eines weltweit einzigartigen Experiments. Drei Wochen vorher rief das Team rund um Produzent Ridley Scott (Alien, Gladiator) und Regisseur Kevin MacDonald (Last King of Scotland, State of Play) die gesamte Youtube-Community auf, an besagtem Tag ihr Leben zu dokumentieren. Das Ergebnis ist überwältigend: 80.000 Clips aus 192 Länder wurden eingereicht, und addierten sich zu einer Laufzeit von 4.500 Stunden Videomaterial. Keine leichte Aufgabe diese Masse auf 95 Minuten zu reduzieren.
Doch die Mühe hat sich gelohnt. Kevin MacDonald gelingt eine dithyrambische Ode an das Leben im 21. Jahrhundert. Verspielt, heiter, vergnügt, tiefgründig, melancholisch, tragisch, erschreckend, dynamisch und unterhaltsam verbindet dieses Zeitdokument bedeutungsschwer mit trivial, profan mit sakral, und deckt somit das ganze Emotionsspektrum, sowohl beim Protagonisten als auch beim Betrachter. Ridley Scott's Mosaik zielt auf die Empathie des Zuschauers, kitzelt das Zwerchfell, entlockt einem so manche Träne, regt aber jedenfalls zum Nachdenken an.
Die Erzählung folgt chronologisch dem alltäglichen Ablauf, beginnt mit dem Erwachen in den frühen Morgenstunden, und endet mit dem Lichtausschalten kurz vor Mitternacht. Anfang und Ende werden hier in jeder möglichen Analogie wiederholt. Bei der Geburt seines Kindes fällt der filmende Vater in Ohnmacht; assoziativ folgt darauf das Töten eines Rindes im Schlachthof. Das Leben im Zeitraffer. Zwischen Geburt und Tod ist fast alles was beginnen, und wieder enden kann im Leben eines Individuums, vertreten. So sieht man beispielsweise einen jungen Mann der seine Partnerin in Las Vegas kniend mit einem Heiratsantrag überrascht, und nur wenige Augenblicke später einen anderen der von seiner Freundin verlassen wird, bevor es eigentlich begonnen hat. Die scheinbar einzige Konstante im Leben scheint die platonische Liebe zu sein, die der Film regelrecht feiert.
Um innerhalb dieses Bilder-Potpourri halbwegs eine Struktur herzustellen, wird die Erzählung in drei Kapitel-ähnliche Fragen eingeteilt: Was liebst du? Was fürchtest du? Was hast du in deiner Tasche? Erstaunlich was da alles an Antworten auftaucht. Und die Menschen scheinen sich eine Freude daraus zu machen sich mit ihren intimsten Vorlieben und Ängsten der ganzen Welt zur Schau zu stellen. Dieser Film ist der perfekte Spiegel für den Trend von globaler Dimension, der durch Facebook, Myspace, Twitter, Youtube und co. sichtbar wird: die ständig wachsende Tendenz des Menschen zum Exhibitionismus und exzessiver Selbstdarstellung. Durch die weltweite Vernetzung wird jeder Person mit Internetzugang ihre Chance auf die berüchtigten 15 Minuten Ruhm (in "Life in a Day" nur noch 15 Sekunden) um ein Vielfaches erleichtert. Folglich wird der Zuschauer gezwungenermaßen in die Rolle des Voyeurs gedrängt. Der dermaßen tiefe Einblick ins Privatleben mancher Menschen, den dieser Film gewährt, mag auf den Ein- oder Anderen verfremdend wirken. Konsequenterweise können Zweifel an der Authentizität des Gezeigten auftreten. Man ist eben nicht gewohnt das echte Leben im Kino zu beobachten.
Zusätzliche Zweifel kommen bei einigen Aufnahmen auf, die offensichtlich nicht von einfachen Privatleuten stammen. Die Kameraoptik mancher Bilder lässt erahnen daß Ridley Scott wohl seine Kamerateams in die entlegensten Ecken der Welt geschickt hat, um möglichst viel vom Globus zu decken. "Life in a Day" ist seinem Mantra also nicht treu, und bricht seine eigene Regeln.
Ein Kontrapunkt in der Narrative ist die Katastrophe auf der Duisburger Loveparade, deren beunruhigende Bilder erst gegen Ende des zweiten Drittel zum Einsatz kommen. Der Film schafft während diesen wenigen Minuten in Kombination mit Musik und Originalton eine verstörende Atmosphäre, die den damaligen Horror wohl authentisch wiedergeben muss. Fast noch erschreckender als die Bilder selbst ist der Ton, der über die psychedelischen Techno-Beats hinaus, sowohl Jubelschreie als auch Angstschreie erkennen lässt. Die Einen tanzen und feiern extatisch, während nur wenige Meter weiter, infernalische Zustände herrschen, und Andere sterbend auf der Straße liegen. Man fühlt sich erleichtert wenn die Szene vorbei ist.
Die letzten Minuten des Films bestehen aus dem Monolog einer jungen Frau, die sich gegen Mitternacht im Auto sitzend selbst auf Videoband aufnimmt, und uns gesteht, daß sie den ganzen Tag vergebens auf "etwas besonderes" gewartet hat, das schlussendlich nie eingetreten ist. Mit großer Enttäuschung stellt sie fest, daß der Tag wohl stinknormal war. Und doch fühlt sie sich als wäre der Tag einzigartig.
Während am Nachthimmel ein Gewitter aufzieht, bringt sie dann die Essenz des Filmes auf den Punkt: es gibt keinen normalen Tag. Jeder Tag ist ein Geschenk das man auskosten soll. Die altbekannte Leier also, Carpe Diem. Letztendlich lässt sich aus diesem exorbitanten, weltumfassenden Projekt, trotz seines Größenwahns, doch nur die Weisheit eines Glückskeks herausdestillieren.
Zusammenfassend ist "Life in a Day" ein äußerst intressantes Experiment, und schon alleine wegen der frischen Idee sehenswert. Zukünftige Generationen werden dankbar sein für dieses wertvolle Zeitdokument, das bezeugt wie es gewesen sein muss, am 24. Juli 2010 auf dem Planeten Erde gelebt zu haben.
Fazit: unterhaltsames, süß-saueres Patchwork-Werk, das dem Zuschauer noch eine Weile im Kopf nachhallen, und einen mit existentiellen Fragen beschäftigen wird. Sollte man gesehen haben.
5/6 Sterne.
M!LLi Schlesser