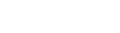Buergsonndig zu Draufelt

“Wéi den Damp op Buergsonndig geet, esou geet en de ganze Virsummer”. …..
Am ersten Fastensonntag (Invocabit) wird auf „Malek“ einer Anhöhe am Rande des Dorfes Drauffelt die Burg gebrannt. Seit Jahrhunderten ersetzt das Burgfeuer das ursprüngliche Fastenfeuer dieses Sonntags, als sogenanntes Frühlingsfeuer zwischen dem Winter und dem Sommerhalbjahr. Auch wenn die Zeit von Mitte Februar bis Mitte März im Ösling verfrüht scheinen mag, so ist der Brauch seit jeher auf diesem Sonntag am Beginn der Fastenzeit.
Die Fastensonntage sind die Sonntage in der großen Fastenzeit (lat. Quadragesima). Diese wird in der katholischen Kirche auch als österliche Bußzeit bezeichnet und umfasst vierzig Werktage zwischen Aschermittwoch und Ostern (lateinisch Quadragesima „Vierzigster“).
Invocabit me, et ego exaudiam eum - „Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören“
Trotz aller gebotener Vorsicht um die Entstehung und dem eigentlichen Sinn dieser Tradition darf man darin ein Symbol aus der heidnischen Zeit sehen. Der Brauch versinnbildete früher den Sieg der Sonne über den Winter und wurde nur von Erwachsenen unter grosser Andacht vorgenommen. Neben dem Verbrennen war es auch ein magisches Ritual zur Erweckung der Lebenskraft.
Ein vielleicht noch älterer Brauch war das Johannisfeuer am 24. Juni, in der kürzesten Nacht des Jahres. Dieses Feuer sollte alles Gute für Mensch und Tier herbeiführen und Unheil abwenden. Holz, Reisig, ausgediente Besen, Stroh und Werk (Abfall des gehechelten Flaches und Hanfes) werden auf den Haufen gebracht. In diesem Feuer wurden in Säcke und Körbe eingefangene lebendige Katzen verbrannt, ein Akt der Austreibung eines jahreszeitlichen Dämons.
Das „Burgfeuer“ im Ösling hat seine Bezeichnung in der Westeifel, unterhalb von Vianden und Kyllburg, mit „Hüttefeuer“. Und dabei hat das Wort Burg oder "Buerg" nichts mit einer Burg im heutigen Sinne zu tun. Es geht auf das lateinische Verb "comburere", also "verbrennen" zurück. So wird auch davon ausgegangen, dass die Tradition des Burgbrennens auf die Neujahrsfeste im antiken Rom zurückgeht, wo das Jahr am 1. März begann. In Diekirch findet man im Jahre 1777 einen Beleg der den „auff burg sontag“ erwähnt.
Ältere Zuschauer hielten früher nach den Burgen der Umgebung und dem Winde Ausschau und pflegten zu sagen:
‚Wivill Buergen ech gesinn, souvill Joer ech der nach gin‘ und ‚Wéi den Damp op Burgsonndig geet, esou geet en de ganze Virsummer’.
Ostwind am Burgsonntag gilt als Hinweis auf einen trockenen, kalten Frühling. Der Westwind bringt viel Regen und Nässe. Gutes Heuwetter ist angesagt, wenn an diesem Festtag die Sonne scheint.
Dee Sonndeg kann am Duerf all Mënsch weisen, ier en eppes vom Wieder kennt. Ween Liichtmëssdag an der Mass fir d’lescht affere geet ass de Wiedermécher fir dëst Joer. Ma Buergsonndeg däerf jiddereen profezeien.
„ Wéi de Jang van …..“, sot d’Guet, „deen haten se gestëmmt, well en doruechter téine gung, hie méich hinnen d’Wieder. Ma du haten se véierzeng Deeg iwwerhaapt keent.“
Lange Zeit soll die Asche vom Burgfeuer als wertvollen Dünger auf die Felder ausgebracht worden sein.
Im Drauffelt der sechziger Jahre war der Aufbau der Burg noch eine Aufgabe der Jungen, der Messdiener. Unterstützung gab es durch einige Väter, die beim Aufrichten des Kreuzes und mit dem Traktor beim Einsammeln in Dorf halfen. Wenn die „Buerg“ dann fertig war durften auch die Mädchen dazukommen. Im Grunde genommen waren sie von diesem Brauch seit jeher ausgeschlossen. Mädchen, die sich trotzdem zeigten, wurden zur Strafe die Gesichter mit Russ oder Kohle geschwärzt. Und die Eier, die das geschwärzte Mädchen dem Burschen schuldete, waren nicht mit einem Fruchtbarkeitszauber in Verbindung zu bringen, sondern hatten ihre Herkunft in den Lehengaben, die mit dem ersten Fastensonntag verbunden waren.
An die Stelle von Beschwörung sind in den letzten Jahrhunderten christliche Lieder und Gebete eingesetzt worden. Das Christentum verwarf all diese Begründungen und ersetzte die Bräuche durch religiöse Inhalte, da sie im Volk nicht auszumerzen waren. So wurde beispielsweise aus dem Vegetationskult ein Beten und Singen um gutes Gedeihen. Das Höhenfeuer, die Sonnenwendfeuer oder das Johannisfeuer wurden „umgedeutet“ zu „Begrüßungsfeuern“ des Frühlings. So sollen Leute während dem Abbrennen des Feuers fünf Vaterunser und ein Glaubensbekenntnis beten. Auch in dieser Zeit fand das Kreuz einen Platz auf der Burg und die Tradition bekam ihr christliches Gesicht.
Am Vormittag des Burgsonntags fährt der Heische Zug durchs Dorf, um Geld und alles brennbare Material einzusammeln. Früher musste alles mit Heische Liedern ersungen werden. Die Heische Lieder sind örtlich nach Sinn und Dialekt verschieden. Das Heische Lied, das am Burgsonntag in Esch-Sauer vorgetragen wurde, lautet so:
Eppes gesteiert fir eng al Beienheip!
Eppes gesteiert fir d’Buurg!
déi al, déi ass derduurch.
Stréi, Stréi fir déi nei Buurg!
déi al, déi ass derduurch.
Weit sichtbar leuchten auf den Höhen des Öslings die „Buergfeier“ in die Nacht hinein. Am Horizont gleichen sie riesigen Fackeln: Erinnerungen an vorgeschichtliche Rituale? Tiefsitzende Wurzeln alten Brauchtums werden hier freigelegt, wo die Vorzeit lange Fährten und breite Spuren im Öslinger (Eifeler) Volksglauben hinterlassen hat. Dank der brauchbetonten Stellung des jüngsten Ehepaares aus dem Dorf dürfen die jungen Eheleute am Abend das Feuer anzünden und die Dorfgesellschaft mit Essen und Trinken versorgen. Mittlerweile ist in Drauffelt das jüngste Ehepaar seit fünf Jahren im Amt und macht seiner Stellung im Dorfleben nach wie vor alle Ehre.
Um das Burgbrennen zu rechtfertigen, sagten die wallonischen Bauern: Si nous n’allumons pas les petits feux, Dieux allumera les grands feux, was auf Brandunglück, Dürre oder Blitzschlag gedeutet werden kann. Das ist wohl keltische Ansicht, denn die Wallonen sind im Luxemburgischen die direktesten Nachkömmlinge dieses Volkes.
Im belgischen Grenzgebiet (Ostkantone) besteht der Brauch ebenfalls. Vor dem Entzünden der Burg treffen sich die Dorfleute beim Eierkuchenschmaus. Hier besteht aber auch der Brauch vom Singen der Burg-Lieder. Hier folgt nun als Beispiel im Dialekt, das Lanzerather Burg-Lied, von dem es eine Version für die Jungen und eine für die Mädchen gibt:
die Jungen singen:
Strüh, Strüh zur neuer Burg
die Al die os verbrannt
die Neu die kütt ont Land
jett os jett un lot os john
mir han der Düre noch vill ze john
mir han en Kont us Strüh jemaht
wen soll et döfe
den Herr mot de Knöfe
tirelireousch en schun Strühbousch
un en schune Böggel Jeld.
die Mädchen singen:
Guten Tag, ihr Leute,
hier kommen Große und Kleine
Wir sind gekommen an die Tür.
Stellt Lejder ant Wand
holt Metz ont ret Hand.
Schneck hüh, schneck def,
schneck en schunne Speckjreef!
En halef dozend Eier!
Mach euch keine Beschwerde daraus,
wir essen uns satt in unserm Haus.
Dann hat de Vader om Himmel ösch leef.
Der dreimalige Gang um die brennende „Buerg“ ist ein Brauch, der nur Göttern zu Ehren geschehen kann. Bräuche sind Volksgut, ja ein Stück Kultur. Einmalig für eine Region, unverwechselbar und notwendig. Sie spiegeln das wider, was sich ein Volk, eine Region, eine Kulturlandschaft über Jahrhunderte erarbeitet und bewahrt hat.
Ob Mundart, Liedgut, Moden oder praktische Handlungen – Bräuche „verraten“ etwas von Traditionsbewusstsein, Identität und Einsatz für eine gewisse Heimatregion, für Menschen und deren Dorf.
Wenn wir von „Brauchtum“ reden, ist zumeist von „Volksbrauchtum“, religiösem oder ländlich-bäuerlichem Brauchtum die Rede. Bräuche sind im Volk „gewachsen“, nicht verordnet. Bräuche werden „gebraucht“, besser gesagt angewendet, um mit ihrer Hilfe gewisse Dinge symbolisch oder in der Praxis zu erklären. Außerdem haben sie den hohen Stellenwert, zur Sozialisierung beizutragen und damit einen wichtigen Dienst für die Allgemeinheit wahrzunehmen.
Ein Brauch braucht auch immer ein Stück Öffentlichkeit, denn er war und ist nie Selbstzweck, sondern er macht nur im Kontext mit anderen Menschen Sinn. Brauchtum meint in aller Regel das ländlich-religiöse Brauchtum, denn dieses hat in den vergangenen Jahrhunderten eine ungeheure Vielfalt, Größe und Wichtigkeit erlangt. Aber der Charakter der Bräuche und das Engagement der Brauchträger haben erheblich verändert. Nicht selten ersetzen Missbrauch und „ungute Sitten“ die überlieferte Tradition.
Abschließend und zum Nachdenken sei hier ein Satz von Bertold Brecht eingefügt: „Aber wer den großen Sprung machen will, muss einige Schritte zurückgehen. Das Heute geht gespeist durch das Gestern in das Morgen.”
Quellen :
Joachim SCHROEDER : Strohmann, Fackeln und Räder
Edmond DE LA FONTAINE : Luxemburger Sitten und Gebräuche
Joachim SCHROEDER : Brauchen wir Bräuche?
Geschichtsblatt: Zwischen Venn und Schneifel
Alain ATTEN: 2016 zu Draufelt erzallt