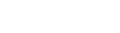Obwohl das Weinbauinstitut schon seit 2001 untersucht, wie effektiv biologische Spritzmittel gegen Pilzkrankheiten wirken, erfolgen Versuche erst ab diesem Jahr mit dem Hubschrauber. Die Winzer der Helikopterspritzgenossenschaft Wormeldingen haben sich der Versuchsreihe angeschlossen. Dies aus mehreren Gründen.
Im Frühjahr sind die Spritzhelikopter an der Luxemburger Mosel unterwegs. Dann werden konventionelle Produkte, also keine ökologischen Mittel, über die Lagen zwischen Schengen und Wasserbillig gesprüht. Dies wird insbesondere an Steillagen gemacht, beziehungsweise an Lagen, die schwer zu begehen sind. Mit diesen Maßnahmen wird versucht, Pilzkrankheiten wie Oïdium und Peronospora unter Kontrolle zu halten. „Diese konventionellen Produkte sind für die Menschen in der zugelassenen Aufwandmenge nicht schädlich“, betont Robert Mannes, zuständig für die Beratung im ökologischen Weinbau beim Weinbau-Institut (IVV). Es gäbe sehr viele strenge Untersuchungen, bei denen genau darauf geachtet werde, ob die Auflagen eingehalten werden.
Dennoch ist die Nachfrage für Weine aus ökologischem Anbau vorhanden. Sie steigt sogar mit den Jahren. Das Weinbau-Institut hat einige Parzellen reserviert, in denen Mittel mit dem Hubschrauber ausgebracht werden, die auf natürlicher Basis fußen. Es handelt sich um Naturprodukte, wie zum Beispiel Schwefel gegen Oïdium und Kupfer sowie spezielle Blattdünger gegen Peronospora. Das IVV beobachtet dabei sehr genau, ob dieses Verfahren Früchte trägt. „Ziel dieses Projektes wird es sein, über einen Zeitraum von drei Jahren die Hubschrauberspritzung mit ökologischen Produkten auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen“, erklärt Mannes. Wenn die Ergebnisse als effizient betrachtet werden, dann könne diese Art von Spritzung ganz sicher in der Praxis angewandt werden.
Doch auch einige Luxemburger Winzer beschreiten diesen Weg. Von den 16 Spritzgenossenschaften, die es an der Luxemburger Mosel gibt, ist es die aus Wormeldingen, die in diesem Jahr den Versuch unternimmt, mit Naturprodukten gegen die Pilzkrankheiten vorzugehen. Die Steillage „Koeppchen/Nossbaam“ über sieben Hektar und die flache Lage „Iwent-Wenkelgewaan“ (fünf Hektar) sind dafür ausgewählt worden.
„Dass wir uns diesem Versuch angeschlossen haben, liegt daran, dass wir von der Wormeldinger Spritzgenossenschaft in die Zukunft investieren möchten“, erklärt Präsident Fernand Pundel. Vier Beweggründe zählt er auf. „Wir möchten den Konsumenten zeigen, dass wir bereit sind, den Weg mit biologischen Mitteln zu gehen“, sagt Pundel. Wichtig sei aber, dass der Ertrag vorhanden sei. Schließlich müssen die Winzer von ihrem Beruf leben können. Der dritte Grund sei die Arbeitserleichterung, insbesondere in den Steillagen, also in den Arealen mit einem Gefälle ab 30 Prozent. Last but not least sei es von Bedeutung, die Weichen zu stellen, um junge Winzer, beziehungsweise potenzielle Nachfolger für den Beruf zu gewinnen.
Der Versuch, mit dem Helikopter gegen die Pilzkrankheiten vorzugehen, geht auch für sie über drei Jahre und bedeutet für die etwa 20 angeschlossenen Winzer der Wormeldinger Helikopterspritzgenossenschaft zusätzliche Arbeit. Im Verlauf der Saison müssen sie, zusammen mit den IVV-Mitarbeitern, noch genauer als sonst überprüfen, ob die Maßnahmen Wirkung zeigen. „Natürlich gehen diese Winzer ein Risiko ein“, sagt Pundel. Deswegen könne er sich nicht genug für ihre Bereitschaft bedanken. Sollte trotzdem Befall während der Vegetationsperiode auftreten, müssen die Hubschrauberspritzungen teilweise durch Behandlungen mit ökologischen Produkten vom Boden aus ersetzt werden. Während der Versuchsreihe in Wormeldingen werden mit Ausnahme vom Elbling alle Rebsorten getestet. Insbesondere sei man gespannt auf den Rivaner, da dieser im Vergleich zu den anderen Sorten als besonders empfindlich gelte. In Deutschland sind solche Verfahren mehrmals in der Praxis untersucht worden. Die Forschungsanstalt Geisenheim verfügt bereits über Resultate. Allerdings sind die klimatischen Bedingungen im Rheingau anders als an der Luxemburger Mosel. Auch sind Unterschiede zwischen den Rebsorten festzustellen.
Privatwinzer, Genossenschaftswinzer und die Winzer aus dem Weinhandel nehmen an diesem groß angelegten Versuch teil. Sie können allerdings im Rahmen dieser Versuchstätigkeit nicht auf das Bio-Label zurückgreifen. Das kommt erst in Frage, wenn die, an einer Bio-Zertifizierung interessierten Winzer danach über mindestens drei Jahre hinweg ihre Reben ausschließlich mit natürlichen Produkten behandeln und düngen.Obwohl das Weinbauinstitut schon seit 2001 untersucht, wie effektiv biologische Spritzmittel gegen Pilzkrankheiten wirken, erfolgen Versuche erst ab diesem Jahr mit dem Hubschrauber. Die Winzer der Helikopterspritzgenossenschaft Wormeldingen haben sich der Versuchsreihe angeschlossen. Dies aus mehreren Gründen.
Im Frühjahr sind die Spritzhelikopter an der Luxemburger Mosel unterwegs. Dann werden konventionelle Produkte, also keine ökologischen Mittel, über die Lagen zwischen Schengen und Wasserbillig gesprüht. Dies wird insbesondere an Steillagen gemacht, beziehungsweise an Lagen, die schwer zu begehen sind. Mit diesen Maßnahmen wird versucht, Pilzkrankheiten wie Oïdium und Peronospora unter Kontrolle zu halten. „Diese konventionellen Produkte sind für die Menschen in der zugelassenen Aufwandmenge nicht schädlich“, betont Robert Mannes, zuständig für die Beratung im ökologischen Weinbau beim Weinbau-Institut (IVV). Es gäbe sehr viele strenge Untersuchungen, bei denen genau darauf geachtet werde, ob die Auflagen eingehalten werden.
Dennoch ist die Nachfrage für Weine aus ökologischem Anbau vorhanden. Sie steigt sogar mit den Jahren. Das Weinbau-Institut hat einige Parzellen reserviert, in denen Mittel mit dem Hubschrauber ausgebracht werden, die auf natürlicher Basis fußen. Es handelt sich um Naturprodukte, wie zum Beispiel Schwefel gegen Oïdium und Kupfer sowie spezielle Blattdünger gegen Peronospora. Das IVV beobachtet dabei sehr genau, ob dieses Verfahren Früchte trägt. „Ziel dieses Projektes wird es sein, über einen Zeitraum von drei Jahren die Hubschrauberspritzung mit ökologischen Produkten auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen“, erklärt Mannes. Wenn die Ergebnisse als effizient betrachtet werden, dann könne diese Art von Spritzung ganz sicher in der Praxis angewandt werden.
Doch auch einige Luxemburger Winzer beschreiten diesen Weg. Von den 16 Spritzgenossenschaften, die es an der Luxemburger Mosel gibt, ist es die aus Wormeldingen, die in diesem Jahr den Versuch unternimmt, mit Naturprodukten gegen die Pilzkrankheiten vorzugehen. Die Steillage „Koeppchen/Nossbaam“ über sieben Hektar und die flache Lage „Iwent-Wenkelgewaan“ (fünf Hektar) sind dafür ausgewählt worden.
„Dass wir uns diesem Versuch angeschlossen haben, liegt daran, dass wir von der Wormeldinger Spritzgenossenschaft in die Zukunft investieren möchten“, erklärt Präsident Fernand Pundel. Vier Beweggründe zählt er auf. „Wir möchten den Konsumenten zeigen, dass wir bereit sind, den Weg mit biologischen Mitteln zu gehen“, sagt Pundel. Wichtig sei aber, dass der Ertrag vorhanden sei. Schließlich müssen die Winzer von ihrem Beruf leben können. Der dritte Grund sei die Arbeitserleichterung, insbesondere in den Steillagen, also in den Arealen mit einem Gefälle ab 30 Prozent. Last but not least sei es von Bedeutung, die Weichen zu stellen, um junge Winzer, beziehungsweise potenzielle Nachfolger für den Beruf zu gewinnen.
Der Versuch, mit dem Helikopter gegen die Pilzkrankheiten vorzugehen, geht auch für sie über drei Jahre und bedeutet für die etwa 20 angeschlossenen Winzer der Wormeldinger Helikopterspritzgenossenschaft zusätzliche Arbeit. Im Verlauf der Saison müssen sie, zusammen mit den IVV-Mitarbeitern, noch genauer als sonst überprüfen, ob die Maßnahmen Wirkung zeigen. „Natürlich gehen diese Winzer ein Risiko ein“, sagt Pundel. Deswegen könne er sich nicht genug für ihre Bereitschaft bedanken. Sollte trotzdem Befall während der Vegetationsperiode auftreten, müssen die Hubschrauberspritzungen teilweise durch Behandlungen mit ökologischen Produkten vom Boden aus ersetzt werden. Während der Versuchsreihe in Wormeldingen werden mit Ausnahme vom Elbling alle Rebsorten getestet. Insbesondere sei man gespannt auf den Rivaner, da dieser im Vergleich zu den anderen Sorten als besonders empfindlich gelte. In Deutschland sind solche Verfahren mehrmals in der Praxis untersucht worden. Die Forschungsanstalt Geisenheim verfügt bereits über Resultate. Allerdings sind die klimatischen Bedingungen im Rheingau anders als an der Luxemburger Mosel. Auch sind Unterschiede zwischen den Rebsorten festzustellen.
Privatwinzer, Genossenschaftswinzer und die Winzer aus dem Weinhandel nehmen an diesem groß angelegten Versuch teil. Sie können allerdings im Rahmen dieser Versuchstätigkeit nicht auf das Bio-Label zurückgreifen. Das kommt erst in Frage, wenn die, an einer Bio-Zertifizierung interessierten Winzer danach über mindestens drei Jahre hinweg ihre Reben ausschließlich mit natürlichen Produkten behandeln und düngen. (jvdh)