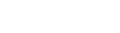In diesem Jahr starteten das Weinbau-Institut (IVV) und die Helikopterspritzgenossenschaft Wormeldingen ein Projekt, bei dem die ökologische Hubschrauberspritzung als wissenschaftlicher Versuch zur Geltung kam. Nach einem Jahr fällt die erste Zwischenbilanz fast ergebnislos aus. Die teilnehmenden Winzer sind mit dem Jahr 2011 äußerst zufrieden, aber aussagekräftige Ergebnisse liegen nicht vor.
Das Projekt ökologische Hubschrauberspritzung in Luxemburg hat das Ziel, diese über einen Zeitraum von drei Jahren mit ökologischen Substanzen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Pilzkrankheiten wie Oïdium und Peronospora, die sich an der Mosel in der Regel viel und schnell verbreiten, wurden in den betroffenen Gebieten nicht mehr mit konventionellen Mitteln bekämpft. In Zusammenarbeit mit der Helikopterspritzgenossenschaft von Wormeldingen wurden die Steillage „Koeppchen/Nossbaam“ (sieben Hektar) und die flache Lage „Iwent-Wenkelgewaan“ (fünf Hektar) auserkoren. Außerdem hat das IVV auch noch in Remich einige Versuchsfelder. Die Untersuchungen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem „Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel“ aus Rheinland-Pfalz sowie mit dem „Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann“. Gegen die Peronospora werden die Rebschutzmittel Frutogard und Kupfer verwendet und zur Bekämpfung von Oïdium Netzschwefel. Die für den Versuch gewählten Rebsorten sind Rivaner und Elbling.
Doch zu aussagekräftigen Ergebnissen im ersten von insgesamt drei Probejahren ist es gar nicht gekommen. Die beiden Pilzkrankheiten traten im Jahr 2011 so gut wie gar nicht auf. „Das Wetter war einfach zu gut“, erklärt Fernand Pundel, Präsident der Wormeldinger Helikopterspritzgenossenschaft.
Bis kurz nach der Blüte habe man auf den zwölf Hektar ausschließlich mit biologischen Substanzen gearbeitet, danach sei man sicherheitshalber auf konventionelle Mittel umgestiegen. „Wir wollten kein hohes Risiko eingehen“, blickt Pundel auf Anfrage zurück. „Es geht ja schließlich um unsere Einkünfte.“
Unter dem Strich habe man zu 70 Prozent mit biologischen und 30 Prozent mit konventionellen Mitteln gearbeitet, ergänzt Roger Demuth, Vizepräsident von Protvigne, das unter anderem die lokalen Hubschrauberspritzgenossenschaften in all ihren Arbeiten unterstützt. Diese Mischung sei optimal, auch wenn man im kommenden Jahr möglichst viel auf Bio setzen möchte.
Beim IVV leitet Robert Mannes dieses Projekt. „Der große Unterschied besteht darin, dass mit Bio-Substanzen vorbeugend gearbeitet wird“, sagt er. „Mit diesen Substanzen kann ein bereits hoher Pilzbefall nicht mehr beseitigt werden.“ Aus diesem Grund werde es für die Winzer immer wichtiger, die Wetterprognosen genau zu verfolgen und schnell zu handeln.
Auch wenn Winzer ihre Areale noch intensiver überwachen müssen und die Bio-Hubschrauberspritzung kostenaufwändiger ist als bei den herkömmlichen Methoden, ist die Helikopterspritzgenossenschaft Wormeldingen davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg auch der richtige ist. In diesem Jahr wurden zwölf von insgesamt 110 Hektar für die Versuche genutzt, 2012 könnte die Fläche durchaus größer sein. „Das Feedback von unseren Winzern ist positiv“, sagt Pundel. „Sie stehen weiterhin hinter diesem Projekt.“ Man sei gewillt, auch in den kommenden beiden Jahren die Versuchsreihe fortzusetzen. Erst dann soll die Entscheidung fallen, ob die Winzer der Wormeldinger Helikopterspritzgenossenschaft endgültig auf konventionelle Methoden verzichten. (jvdh / Foto: Serge Garidel)